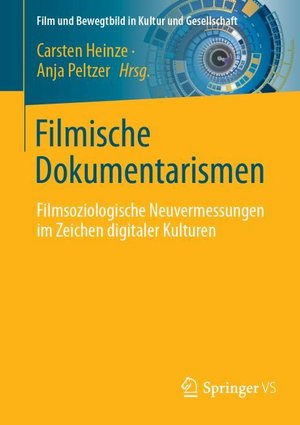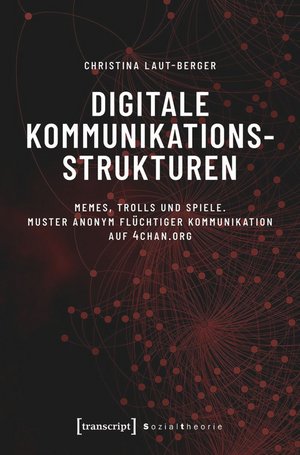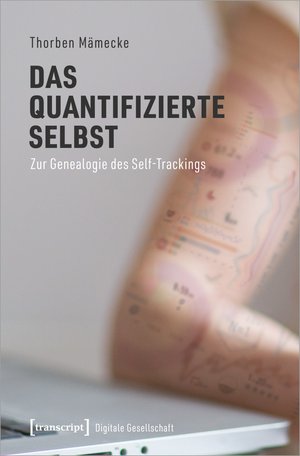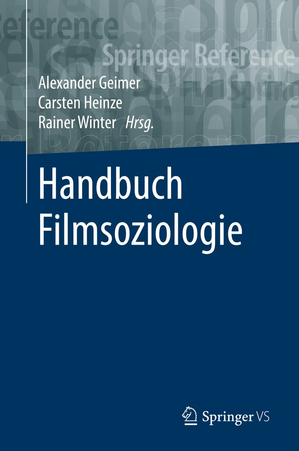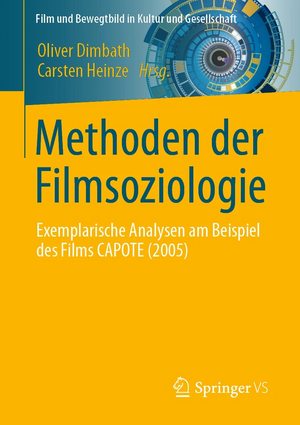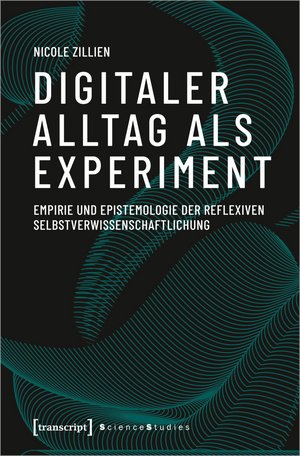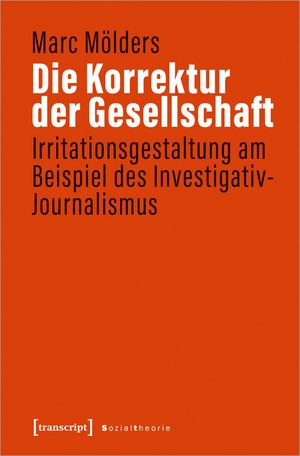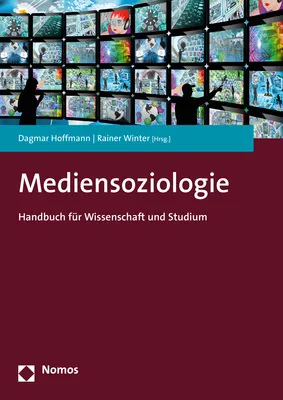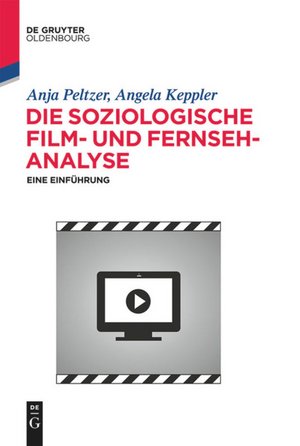Publikationen der Sektion
Publikationen der Sektion
Peltzer, Anja & Heinze, Carsten (Hg.) (2025): Filmische Dokumentarismen. Filmsoziologische Neuvermessungen im Zeichen digitaler Kulturen. Wiesbaden: Springer VS
Das Buch bietet filmsoziologische (Neu-)Vermessungen aktueller Konfigurationen des Dokumentarischen unter digitalen Bedingungen. Den empirischen Ausgangspunkt bilden die Ausdifferenzierungen und Veränderungen dokumentarischer Praktiken, die sich in ganz unterschiedlichen filmischen Genres beobachten lassen, von True Crime Formaten, Livestreaming-Rollenspielen, Extremsportvideos über das Quality TV bis hin zum klassischen Dokumentarfilm. Daraus erwachsen im Horizont filmsoziologischer Forschungsfelder ganz neue Herausforderungen, die die Bestimmung des Gegenstands wesentlich betreffen. Denn im Zuge dieser Veränderungen werden grundlegende Fragen zum Zusammenhang von filmischer und sozialer Wirklichkeit, Dokumentation und Fiktion, Realität und Irrealität, Wahrheit und Unwahrheit neu gestellt und müssen beantwortet werden.
Der vorliegende Band führt in einer konzeptionellen Einleitung den Begriff›filmischer Medien‹ein sowie in die Besonderheiten ihres Verhältnisses zur sozialen Wirklichkeit. Daran anschließend gehen die einzelnen Beiträge den filmischen Transitionen des Dokumentarischen unter digitalen Bedingungen an signifikanten Fällen nach und untersuchen u.a. folgenden Fragestellungen: Zeichnen sich filmische Verfahren der Wahrheit, Aufrichtigkeit, Objektivität oder Echtheit in den Produkten ab? In welchem Verhältnis stehen diese Verfahren sowohl zu den tradierten filmischen Formen des Spiel- und Dokumentarfilms als auch zu den digitalen Logiken der Plattformen? Wie verhält sich das Prinzip der Liveness auf den Plattformmedien zur rekonstruktiven Logik des Dokumentarischen? Und schließlich: Was zeigt die Ubiquität des Filmischen – als Beweis, als Geständnis, als Fälschung, als Unterhaltung, als Artefakt, als Epos oder als Zufall – über die kommunikativen Routinen einer Gesellschaft an? Der Band richtet sich an Medien- und Filmsoziolog*innen, Medien- und Filmwissenschaftler*innen sowie Kulturwissenschaftler*innen.
Laut-Berger, Christina (2023): Digitale Kommunikationsstrukturen. Memes, Trolls und Spiele. Muster anonym flüchtiger Kommunikation auf 4chan.org. Bielefeld: Transcript Verlag.
Bekannt durch die Hackergruppierung Anonymous, Pizzagate oder die QAnon-Verschwörungstheorie gibt die englischsprachige Internetplattform 4chan.org Rätsel auf. Jede*r mit Internetzugang kann posten, die Nutzenden sind anonym, ihre Beiträge flüchtig und die Inhalte werden nicht moderiert. Trotz der daraus resultierenden Erwartungsunsicherheit organisiert sich die Kommunikation selbst und gießt sich in idealtypische Muster. Unter systemtheoretischen Annahmen modelliert Christina Laut-Berger die Kommunikationsstrukturen von 4chan.org anhand eines innovativen, netzwerkanalytischen Forschungsdesigns und leistet so einen Beitrag zur grundlegenden Erforschung digitaler Sozialität.
Mämecke, Thorben (2021): Das quantifizierte Selbst. Zur Genealogie des Self-Trackings. Bielefeld: Transcript Verlag
Im Jahr 2021 sind Self-Tracking-Technologien ein fester Bestandteil gesellschaftlicher Alltagspraxen. In der Gegenwart von Corona-Tracing-Apps und Social Scoring erinnert kaum noch etwas an die frühen Prototypen der technologieenthusiastischen Self-Tracker*innen. Thorben Mämecke wirft einen Blick auf die intensiven Beziehungen, die diese Pionierprojekte untereinander gepflegt haben, und zeichnet dabei die sie bestimmenden Phänomene nach: angefangen bei der Ellenbogenmentalität der prekären Kreativökonomie bis zum progressiven Selbstbestimmtheitsstreben von Self-Tracker*innen mit chronischen Erkrankungen.
Geimer, Alexander; Heinze, Carsten; Winter, Rainer (2021): Handbuch Filmsoziologie (2 Bände). Wiesbaden: Springer VS
Der Band greift filmsoziologische Fragestellungen in ihren vielfältigen Facetten auf, die von renommierten Wissenschaftler*innen bearbeitet werden. In Überblicksartikeln wird ein Einblick in die zentralen Themenfelder eröffnet. Im ersten Kapitel werden historische Wurzeln und Traditionen am Beispiel bedeutender Filmsoziolog*innen dargestellt und so ein historischer Abriss zu Themen und Problemen der Filmsoziologie gegeben. Im zweiten Kapitel werden theoretische Perspektiven der Filmsoziologie behandelt, im dritten Kapitel verschiedene Methodologien vorgestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit einzelnen Themen des Films und Genreanalysen. Das fünfte Kapitel widmet sich in Abgrenzung zum fiktionalen Film dem dokumentarischen Film in Theorie und Geschichte. Das sechste Kapitel stellt aktuelle Bezugsfelder der Filmsoziologie dar und öffnet Perspektiven für den interdisziplinären Austausch.
Dimbath, Oliver; Heinze, Carsten (2021): Methoden der Filmsoziologie. Exemplarische Analysen am Beispiel des Films CAPOTE (2005). Wiesbaden: Springer VS
Die Beiträge dieses Bandes gehen aus einem Symposion zur Analyse des Spielfilms CAPOTE (2005) hervor, das Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher filmsoziologischer Methoden und Zugänge zusammengebracht hat. Die Fokussierung auf einen Film gewährt einen vergleichenden Blick auf verschiedene Verfahren und die Reichweite ihrer Interpretations- und Deutungspotenziale. Unter den behandelten Ansätzen finden sich Positionen der filmgestützten Interaktionsanalyse, der Seduktionstheorie oder der biografischen Filmanalyse.
Peltzer, Anja, Wieser, Matthias & Zillien, Nicole (Hg.) (2021): Materialität des Digitalen. Heft MedienJournal. Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsforschung 1/2021.
Peltzer, Anja, Wieser, Matthias & Zillien, Nicole (Hg.) (2021): Medien als Dinge denken. Heft MedienJournal. Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsforschung 4/2020.
Nicole Zillien (2020): Digitaler Alltag als Experiment. Empirie und Epistemologie der reflexiven Selbstverwissenschaftlichung. Bielefeld: Transcript Verlag.
In zahlreichen Alltagsfragen gilt wissenschaftliches Wissen als zentrale Bezugsgröße. Zugleich ist es jedoch oft umstritten und somit eine wenig alltagstaugliche Ressource. Im Rückgriff auf digitale Medien machen einige Laien deshalb ihr Leben zum Labor und stellen so etwa in Gesundheits- oder Umweltfragen sukzessiv ein experimentelles Wissen zur eigenen Alltagsbewältigung her. Diese reflexive Selbstverwissenschaftlichung unterzieht Nicole Zillien auf erkenntnistheoretischer Grundlage am Beispiel der digitalen Selbstvermessung einer empirischen Analyse.
Mölders, Marc (2019): Die Korrektur der Gesellschaft. Irritationsgestaltung am Beispiel des Investigativ-Journalismus. Bielefeld: Transcript Verlag.
Über Gesellschaft lässt sich viel lernen, wenn man die Arbeit an ihrer Korrektur untersucht. Globalisierung und Digitalisierung scheinen Korrektiven abseits des Staatlichen eine Sonderposition einzuräumen: Ungekannt schnell und grenzenlos können sie operieren. Marc Mölders zeigt, dass zentrale Gesellschaftsprobleme Übersetzungskonflikte sind und dies nicht nur differenzierungstheoretisch angenommen wird. Anhand des Investigativ-Journalismus – einer Form organisierter Gesellschaftskorrektur – zeichnet er nach, wie eine durch Tempo-Dosierung und Grenzeinhaltung gekennzeichnete Irritationsgestaltung aus Publikationen ›Druckerzeugnisse‹ macht.
Hoffmann, Dagmar; Winter, Rainer (2018): Handbuch Mediensoziologie. Baden-Baden: Nomos.
Das Handbuch Mediensoziologie bietet einen umfassenden Überblick über zentrale Theorien, Forschungszugänge und Forschungsfelder, die sich dem Verweisungszusammenhang Individuum, Medien und Gesellschaft widmen. Die versammelten Beiträge liefern einen systematischen Zugang zu mediensoziologischen Erkenntnisinteressen, Denkweisen, Erklärungsmodellen und Deutungsangeboten. Vorgestellt werden mikro-, makro- und metatheoretische Ansätze sowie historisch-soziologische Zeit- und Gegenwartsdiagnosen, die die Konstitution von Gesellschaften vorrangig mit ihren Kommunikations-, Medien- und Wissenssystemen in Verbindung bringen. Komprimiert und anschaulich wird der aktuelle Stand der Forschung zu verschiedensten Themenfeldern (u.a. Gender, Körper, Musik, Politik, Sport) und der soziologischen Untersuchung einzelner Medien (u.a. Bild, Film, Fernsehen, Hybridmedien) dargestellt. Das Handbuch befasst sich zudem mit den in der Mediensoziologie hauptsächlich angewandten quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden.
Eickelmann, Jennifer (2017): ›Hate Speech‹ und Verletzbarkeit im digitalen Zeitalter. Phänomene mediatisierter Missachtung aus Perspektive der Gender Media Studies. Bielefeld: Transcript Verlag.
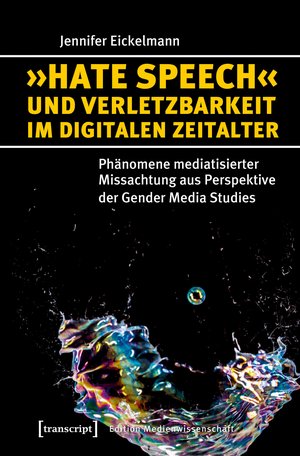
Die Debatten um Hate Speech im Internet zeugen von der Brisanz der Frage, welche Verletzungsmacht diffamierenden Adressierungen inhärent ist: Handelt es sich um einen rein zeichenhaften Ausdruck freier Rede oder um einen ›realen‹ Gewaltakt?
Aus einer dualismuskritischen Perspektive entwickelt Jennifer Eickelmann ein Konzept mediatisierter Missachtung, das sich diesem Entweder-oder verweigert. Entlang materialreicher Analysen zeigt sie die Kontingenz dieser Kommunikationen im Spannungsfeld von Realität/Virtualität auf und legt dar, welche Bedeutung der Kategorie Gender und dem Medialen bei der Konstitution und Wirkmacht mediatisierter Missachtung zukommt.
Peltzer, Anja; Keppler, Angela (2015): Soziologische Film- und Fernsehanalyse. Eine Einführung. Berlin: De Gruyter.
Allgegenwärtig und auf vielfache Weise in den sozialen Alltag eingebettet sind die Produkte aus Film und Fernsehen ebenso Vermittler als auch Archivare gesellschaftlichen Wissens. Wie die medialen Produkte gestaltet sind – und damit zur Produktion von Bedeutung sowie der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit beitragen – danach fragt eine soziologische Film- und Fernsehanalyse. Ihr geht es um eine Interpretation der Einstellungen und Sichtweisen, die durch die Machart des jeweiligen medialen Angebots nahegelegt werden. Im Fokus des Bands steht die konkrete Anwendung der Methode: von der ersten Forschungsidee einer Film- und Fernsehanalyse über die Fall- und Szenenauswahl, die Detailanalyse des Zusammenspiels von Bild und Ton bis hin zu Tipps für die schriftliche Darstellung der Ergebnisse. Jeder Arbeitsschritt dieses qualitativen Verfahrens wird anhand konkreter Beispiele aus der Forschungspraxis nachvollziehbar dargestellt. Als Untersuchungsgegenstände dienen u.a. Fernsehproduktionen wie Jimmy Kimmel Live!, Neo Magazin Royale, Germany’s Next Topmodel, aber auch Filme wie The Bling Ring,Sin City, Margin Call oder The Ides of March. Ziel dieser Publikation ist es, die Leserinnen und Leser zu einer eigenen Film- und Fernsehanalyse anzuleiten.
Das Buch richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende sowie an Lehrende in den Bereichen Soziologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie der Fernseh- und Filmwissenschaft.
- Leitfaden für die Durchführung von Film- und Fernsehanalysen
- Klare Systematik von der ersten Forschungsidee bis zur Darstellung der Ergebnisse
- Beispiele aus der Forschungspraxis
- Software für die Protokollierung audiovisueller Daten
Stegbauer, Christian (Hrsg.) (2012): Ungleichheit aus medien- und kommunikationssoziologischer Perspektive. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Gesellschaften unterliegen einem Wandel. Zu diesem Wandel gehört die zunehmende Verbreitung von Medien im Alltag. Soziale Ungleichheit ist eines der wichtigsten Themen der Soziologie. Beides zusammen betrachtet dieser Band: Thematisiert wird die Entstehung von Ungleichheit bei der Produktion von Medien, bei deren Anwendung und Konsum, bei den Medieninhalten und nicht zuletzt auch in den Medien selbst, wie dies etwa beim Internet der Fall ist. Im Band werden theoretische Zugange und Fallstudien vorgestellt und damit der Stand der Forschung in diesem Bereich erschlossen.
Jäckel, Michael/ Mai, Manfred (Hrsg.) (2008): Medienmacht und Gesellschaft. Zum Wandel öffentlicher Kommunikation. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
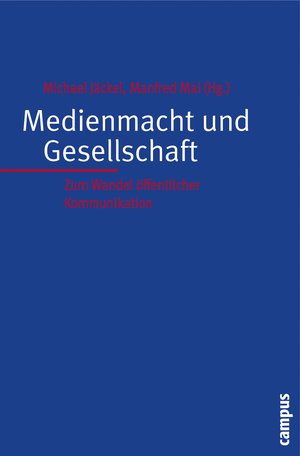
Das Thema Medien und Macht wird von der Öffentlichkeit von jeher kritisch betrachtet. Weckt es doch die Erwartung einer gezielten oder verdeckten Einflussnahme von Meinungen, Einstellungen und Wertehaltungen. Wenn Medienbeobachter heute von ›So viel Macht war noch nie‹ sprechen, meinen sie damit nicht nur die Folgen zunehmender ökonomischer Konzentrationsprozesse und geänderter Besitzverhältnisse. Verstärkt wird auch thematisiert, ob und wie neue Technologien neue Artikulationsformen ermöglichen und damit dem Publikum bzw. den Nutzern eine neue Rolle zukommen lassen. Der Band beleuchtet die ambivalenten Folgen der aktuellen Medienentwicklung.
Stegbauer, Christian/ Jäckel, Michael (Hrsg.) (2008): Social Software. Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Mit Social Software bezeichnet man computernetzwerkgestützte Systeme zur Zusammenarbeit von Teilnehmern. Der Begriff bezieht sich vor allem auf neuere Anwendungen wie Wikis, Weblogs, gemeinsame Fotosammlungen, kollaborativ erstellte Verschlagwortungsseiten und Instant Messaging. In der Regel gilt, dass die Nutzer die jeweiligen Inhalte selbst erstellen und dadurch auch ein Gefühl von Gemeinschaft entsteht bzw. unterstützt wird.
In der Einführung wird ein Überblick über Social Software-Anwendungen gegeben. Dabei werden auch die Herausforderungen für die Medien- und Kommunikationsforschung thematisiert. In den Beiträgen werden Themen behandelt wie die Erstellung von Open Source Software und die Auswirkungen von Weblogs, Wikis, Gesundheitsforen, Online Rollenspielen, Instant Messaging und Social Software in der Organisationskommunikation.
Mai, Manfred/ Winter, Rainer (Hrsg.) (2006): Das Kino der Gesellschaft - die Gesellschaft des Kinos. Interdisziplinäre Positionen, Analysen und Zugänge. Köln: Herbert von Halem Verlag.
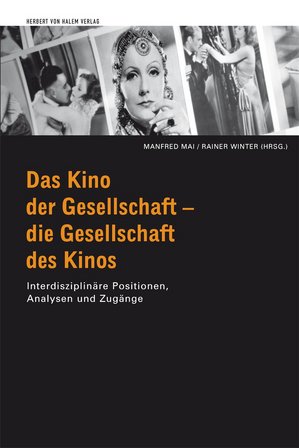
Die Durchdringung unseres Alltagslebens und unserer Fantasien mit Filmen führt zu der Frage, was Filme über die soziale Wirklichkeit aussagen können. Welche Einblicke in soziale, politische und kulturelle Strukturen und Prozesse können uns Kinofilme vermitteln? In welchem Verhältnis steht das Kino zur empirischen Sozialforschung? Filmanalyse sollte immer auch Gesellschaftsanalyse sein. Die ausschließliche Konzentration auf die Filmästhetik oder auf die Rezeption durch ein aller sozialen Bezüge entkleidetes Subjekt führen zu Verzerrungen und zur Ausblendung der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Der vorliegende Band dokumentiert interdisziplinäre - genrehistorische, philosophische, kulturwissenschaftliche, soziologische, psychoanalytische - Fallstudien und Zugänge zum Film. Es zeigt sich, dass durch die Integration unterschiedlicher methodischer Zugänge ein erweitertes Verständnis des Mediums Film sowie konstruktive Forschungsperspektiven für die Filmwissenschaft und Filmsoziologie ermöglicht werden.
Autoren dieses Bandes sind: Dirk Blothner, Lorenz Engell, Ursula Ganz-Blättler, Brigitte Hipfl, Rainer Jogschies, Angela Keppler, Karl Lenz, Manfred Mai, Lothar Mikos, Sebastian Nestler, Olaf Sanders, Markus Wiemker und Brigitte Ziob.
Jäckel, Michael/ Mai, Manfred (Hrsg.) (2005): Online-Vergesellschaftung? Mediensoziologische Perspektiven auf neue Kommunikationstechniken. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
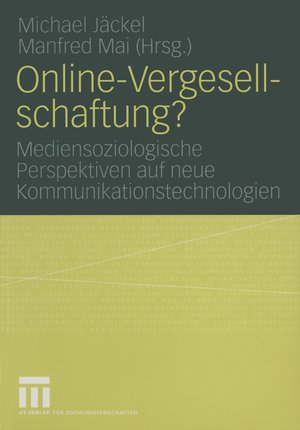
Der soziologische Begriff der Vergesellschaftung ist unter anderem eng verbunden mit den Arbeiten von Max Weber und Georg Simmel. Anknüpfungen an diese Klassiker finden sich zunehmend in aktuellen Untersuchungen zu technisch vermittelten Sozialbeziehungen. Ob die sozialen Prozesse in "virtuellen Gruppen", Chatforen, Videokonferenzen oder Mailinglisten jedoch mit den Begrifflichkeiten der klassischen Gemeinschaft-Gesellschaft-Debatte angemessen erfasst werden können, ist umstritten. Die teils kontroversen Beiträge des Bandes verfolgen das gemeinsame Ziel, die Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien als Prozesse der Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung zu untersuchen. Der Band stellt entsprechende systemtheoretische, netzwerkanalytische, informationswissenschaftliche und techniksoziologische Ansätze vor und gibt auf diese Weise einen umfassenden Überblick zum Themenkomplex der "Online-Vergesellschaftung".
Jäckel, Michael/ Brosius, Hans-Bernd (Hrsg.) (2005): Nach dem Feuerwerk: 20 Jahre duales Fernsehen in Deutschland. Erwartungen, Erfahrungen und Perspektiven. München: Reinhard Fischer Verlag.
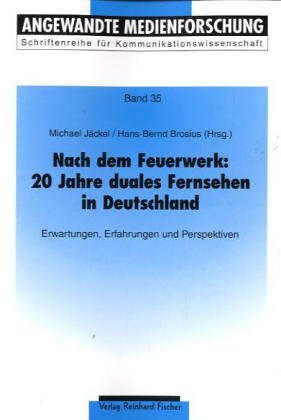
Jahre duales Fernsehen bedeutet 20 Jahre mit wechselnden Kontroversen über die Rolle eines bedeutenden Mediensegments in unserer Gesellschaft. Die ursprünglichen Erwartungen wurden dabei mit Erfahrungen konfrontiert, und das gilt in gleichem Maß für die Medienpolitik, die Medienökonomie, und nicht zuletzt die Zuschauer. Beiträge von: Klaus-Dieter Altmeppen, Hans-Bernd Brosius, Annette Fahr, Michael Jäckel, Walter Klingler, Manfred Mai, Constanze Rossmann, Wolfgang Seufert, Hans-Jörg Stiehle.
Mai, Manfred/ Neumann-Braun, Klaus/ Schmidt, Axel (Hrsg.) (2003): Popvisionen. Links in die Zukunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
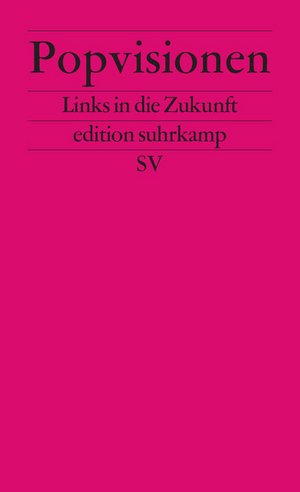
So ungleich wie heute waren die Popjünger noch nie. Das Diktum der neunziger Jahre, daß jeder eine Minderheit sei, ist im Pop auf ganz eigentümliche Weise wahr geworden: Jeder gehört einem anderen Stamm an, befolgt andere Spielregeln, hört andere Musik. Nur eines scheinen alle nach wie vor gemeinsam zu haben: Sie hängen an den alten Popmythen: Ablehnung des Spießertums, Lust auf Freiheit und ein unbändiger Erlebnishunger - im Netz und außerhalb des Netzes.
Was aber stiftet in Zeiten der Globalisierung und Individualisierung Einheit im Pop-Dschungel? Lassen sich globalisierte und internationalisierte Szenen (Techno, HipHop) noch als lebensweltlich fundierte Gemeinschaften begreifen? Sind Szenen durch enorme Binnendifferenzierungen nur noch nominelle Quasi- Gemeinschaften? Wie werden kulturelle Differenzen vermittelt, wie fein sind die Unterschiede geworden? Welche theoretischen Konsequenzen hat die Entdeckung des einenden Prinzips der Distinktion?
Mai, Manfred/ Neumann-Braun, Klaus (Hrsg.) (1999): Von den 'Neuen Medien' zu Multimedia. Gesellschaftliche und politische Aspekte. Baden Baden: Nomos Verlag.
Durch ihre Digitalisierung und globale Vernetzung haben die Medien eine neue Qualität erhalten. So entstehen neue Produkte und Geschäftsfelder sowie neue strategische Allianzen. Diese Entwicklung stellt ebenso wie das Zusammenwachsen von Individual- und Massenkommunikation gerade auch für die Medienpolitik eine wachsende Herausforderung dar.Der Tagungsband der Sektion ›Medien- und Kommunikationssoziologie‹ in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie leistet eine aktuelle Bestandsaufnahme insbesondere zur Internetentwicklung und der Rolle des Fernsehens. Dabei werden interdisziplinäre Ansätze aus Soziologie, Politikwissenschaft, Ökonomie und Rechtswissenschaft herangezogen und mit Berichten aus der Medienpraxis verbunden.Manfred Mai ist Leiter des Referats ›Medienwirtschaft‹ in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei und Vertreter einer Professur für Politikwissenschaft an der Universität Essen. Klaus Neumann-Braun ist Professor für Soziologie an der Universität Frankfurt/Main und als Gutachter für Landesmedienanstalten tätig.